Kapitel 7 - Kontakte zur Universität
Seit dem Sommersemester 1982 bestanden besondere Kontakte zur Universität Trier. Mein Sohn, Diplomgeologe Wolfgang Wagner, Doktorand und Assistent bei Prof. Dr. Negendank an der Universität Trier, dem natürlich von mannigfachen Gesprächen innerhalb unserer Familie her die Probleme des Vereins Sternwarte bestens bekannt waren, brachte bei seinem Doktorvater und beim Präsidenten der Universität, Prof. Dr. Morkel sowie weiteren Professoren des Fachbereichs Geographie, das Vorhaben unseres Vereins zur Sprache und diskutierte mit diesen den Gedanken, auf dem Dach der Universität einen Standort für die so lange geplante Schulsternwarte zu finden.
Das Interesse der Herren war geweckt und so kam es zu ersten, ermutigenden Gesprächen zwischen dem Vereinsvorstand und Vertretern der Universität.
Für uns musste ein Standort auf dem Dach der Universität erhebliche Vorteile bringen. Baumaßnahmen konnten sich auf die Erstellung eines Schutzbaues beschränken, weil die notwendigen Aufenthalts- und Nebenräume in der Uni vorhanden waren und ggf. von uns und den Besuchern der Sternwarte mitbenutzt werden konnten.
Für einen Standort in etwa 260 m Höhe, also gut 120 m über dem Niveau des im Tale gelegenen Stadtzentrums und am Stadtrand gelegen, war zu erwarten, dass die Beobachtungsbedingungen zumindest befriedigen könnten.
Die verkehrsmäßige Anbindung war perfekt.
Mit dem für die bauliche Verwaltung der Universität zuständigen Leiter des Staatl. Hochbauamtes, Herrn Weinspach, fand eine Begehung aller in Frage kommender Standorte auf den Dächern der Universität statt.
Günstigster Platz war nach unserem Urteil das Flachdach des Gebäudes A/B, da es durch eine Fluchttür vom Gebäudeinneren und einen mit Platten belegten Fluchtweg direkt, bequem und sicher zugänglich war.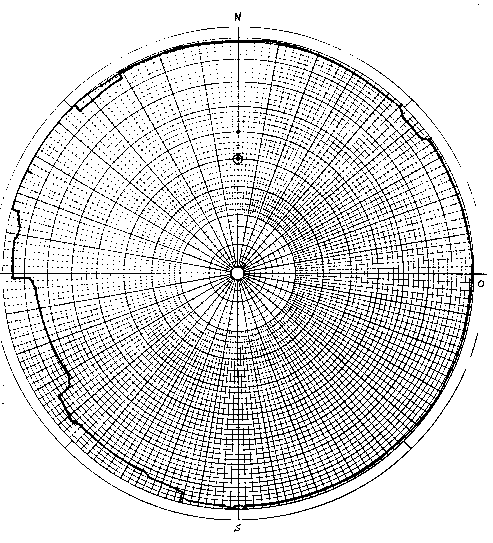 Eine Ausmessung der Horizontsilhouette mit Hilfe des Heidenhain -Newtons ergab, dass der Horizont von Nordwesten über Norden, Osten, Süden bis Südwesten frei zu überblicken war. Geländeerhebungen erreichten keine Höhen, die über dem normalerweise atmosphärisch und wegen hoher Refraktion sowieso ungünstigen horizontnahen Bereich hinausreichten.
Eine Ausmessung der Horizontsilhouette mit Hilfe des Heidenhain -Newtons ergab, dass der Horizont von Nordwesten über Norden, Osten, Süden bis Südwesten frei zu überblicken war. Geländeerhebungen erreichten keine Höhen, die über dem normalerweise atmosphärisch und wegen hoher Refraktion sowieso ungünstigen horizontnahen Bereich hinausreichten.
Einzig im Sektor zwischen Südwesten und Nordwesten ragte der Block des 5. Stockwerks (Gebäude B) mit Treppenhaus und Lift über das Horizontniveau nennenswert hinaus, schirmte aber zugleich die von unten erhellte Dunstglocke über dem Stadtzentrum wohltuend ab.
Die Orientierung des Gebäudes mit breiter Front nach Süden war vorteilhaft, ist doch die Südhälfte des Himmel mit der hier gut zu überblickenden Ekliptik, längs deren sich Sonne, Mond und Planeten bewegen, der bei weitem interessanteste Teil des Sternhimmels.
Relativ günstige Beobachtungsbedingungen also, wenn auch die von den Baugebieten und Parkplätzen in der nahen Umgebung der Universität herrührende "Lichtverschmutzung" des Himmels in Kauf genommen werden musste.
Das Finanzministerium als Verwalter der Baulichkeiten erteilte uns auf Antrag die Genehmigung, einen Fernrohrschutzbau auf dem Dach der Universität zu errichten.
Mit dem Kanzler der Universität, Ignaz Bender, wurden Gedanken über einen Vertrag ausgetauscht, der uns die Errichtung eines solchen Schutzbau gestatten und die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sollte. Erste Entwürfe dazu lagen am 9.8.1984 bei uns vor.
Als Bestandteil des Vertrages wurde die Erstellung einer Benutzungsordnung gefordert. Der Entwurf dieser Ordnung wurde mit den Gymnasiallehrern der Fächer Physik und Geographie als den voraussichtlichen Hauptbenutzern der Sternwarte diskutiert und ausformuliert.
Von der Stadtsparkasse Trier erhielten wir eine Kreditzusage über 80 000.- DM. So konnten die neuen Pläne am 4.7.1985 im Lehrerzimmer des FWG dem erweiterten Vorstand des Vereins, dem in erster Linie die Direktoren der beteiligten Schulen als "geborene Mitglieder" angehören, vorgetragen und die weitere Vorgehensweise beraten werden.

